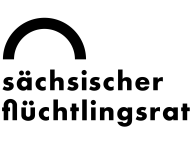Bis zur Machtübernahme durch die Taliban war Said Ramin Rahimi als Rechtsanwalt und Journalist in Afghanistan tätig – auch für deutsche Organisationen. Im Sommer 2022 wurde er evakuiert, da ihn seine Berufstätigkeit unter dem Terrorregime Kabuls in Lebensgefahr brachte. Drei Monate nach seiner Ankunft in Deutschland beginnt er ehrenamtlich im Verein „Willkommen in Bautzen“ aktiv zu werden. Eine lebensverändernde Entscheidung und eine, für die er nun in Berlin ausgezeichnet wurde.
Im Ehrenamt führt er auch ein Projekt durch, um an NS-Verbrechen zu erinnern, wurde er bei „Traces of memory“ honoriert. Rahimi ist heute 29 Jahre alt und lebt gemeinsam mit Mutter und seinem Bruder im ostsächsischen Bautzen. Wir haben ein Gespräch mit ihm geführt, über seine bewegte Vergangenheit in Afghanistan, verbitterte Denkweisen im gegenwärtigen Sachsen und eine Zukunft, in der der Dialog wieder möglich sein wird.
Wie würden Sie ihren beruflichen Alltag in Afghanistan beschreiben?
Mein Alltag als Strafverteidiger, Rechtsberater und juristischer Journalist in Afghanistan war geprägt von Verantwortung, Gefahr und einem tiefen Gefühl der Verpflichtung. In einem Umfeld zu arbeiten, in dem Gerechtigkeit und Meinungsfreiheit permanent bedroht sind, bedeutete, täglich für die Wahrung der Menschenwürde und die Verteidigung der Wahrheit zu kämpfen.
Haben Sie einen derzeitigen Eindruck, was sich im Land abspielt?
Ich führe dieses Gespräch in einem Moment, in dem die Taliban das gesamte Internet in Afghanistan abgeschaltet haben – eine Gruppe, der man kaum das Attribut „menschlich“ zuschreiben kann. Kein Lebewesen im 21. Jahrhundert würde ein ganzes Land in ein solches Gefängnis verwandeln. Kinder haben seit Langem keinen Schulhof mehr gesehen, Frauen leben in einem Zustand völliger Angst und werden auf ihr Geschlecht reduziert, und die Menschen atmen inmitten von Furcht und Hoffnungslosigkeit.
Ich hoffe, dass bis zur Veröffentlichung dieses Interviews die Verbindung der Menschen zur Welt wiederhergestellt ist. Selbst jetzt kann ich nicht völlig frei antworten, denn ich sorge mich um das Leben meiner Angehörigen, die jeden Moment bedroht sein könnten. Trotz all dieser Dunkelheit glaube ich fest daran: Eine Stimme kann nicht zum Schweigen gebracht werden – selbst dann nicht, wenn das digitale Licht erlischt.
Wie haben Sie die letzten Tage vor der Ausreise erlebt?
Ich möchte meine Antwort nicht in der Form eines nüchternen Zeitungsartikels geben. Denn in meinem Kopf erscheint die Geschichte meiner Flucht aus Afghanistan wie eine Reihe von lebendigen, gefährlichen Bildern, die sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Etwa einen Monat vor dem Fall – oder besser gesagt: der Übergabe Afghanistans – schrieb ich einen Text, der sich im Nachhinein als präzise Vorahnung jener Tage erwies:
„Vor manchen Kommen und Gehen muss man sich fürchten. Und ich fürchte mich.
Wenn ein Tier plötzlich aus der Sonne auftaucht, hungrig, mit Schaum wie von einem tollwütigen Hund im Maul, und sich für die Jagd ‚taktisch zurückzieht‘, um dann überraschend die ganze Meute zu rufen…Ich fürchte den gelben Hund, der auf dem Weg in diese Stadt ist, der seinen Schakalen den Tisch deckt und mit dem Verlassen der Stadt den Fall vorbereitet. Ich fürchte, dieser Handel riecht nach ‚Übergabe‘, nach Blut, nach dem wilden Müllhaufen der Geschichte…
Noch immer trägt mein Körper die Narben von Peitschenhieben der Geschichte, und der Name der ‚Ungläubigen‘ ist noch immer Farkhunda. Sie kamen! Sie kamen! Zieh deinen Schleier an, Bibi Gul, während ich mir schnell meinen Lungi um den Kopf binde!“
(Anmerkung: Ein „Lungi“ ist ein traditionelles Tuch, das manche afghanische Männer – besonders in ländlichen Regionen – um den Kopf wickeln.)

Dieser Text war eine schmerzhafte, gefährliche Vorahnung – und sie trat genau so ein. Diese Tage und Nächte waren für mich wie ein Albtraum – Albträume, die mich noch immer im Schlaf verfolgen. Manchmal schreie ich nachts im Schlaf auf und meine Mutter beruhigt mich.
Haben Sie noch Erinnerungen an die Tage bevor Kabul an die Taliban fiel? Schließlich nahmen damals die Kampfhandlungen über Monate extrem zu.
Ich war vielleicht einer derjenigen, die beim Selbstmordanschlag auf die Universität Kabul, am meisten Glück hatten. Zwei Stunden lang waren wir zwischen Staub, Schreien und Blut eingeschlossen, bis wir uns schließlich mit einigen befreundeten Ärzten und dutzenden Studentinnen und Studenten über eine Mauer retteten. Ich habe den Tod mehrmals erlebt – wie einen Geruch, der aus der Ferne in die Nase steigt.
Ich erinnere mich, dass ein Freund – der heute im Ausland lebt – genau in dem Moment, als der Angriff begann, ein Gruppenfoto machte und es seiner Familie schickte, damit, falls wir getötet würden, dieses Bild die letzte Erinnerung an uns wäre.
In Kabul wurde ich morgens nicht vom Wecker geweckt, sondern von den Explosionen klebriger Bomben. Jedes Mal, wenn ich das Haus verließ, verabschiedete ich mich von meiner Familie, als wäre es das letzte Mal. Die Hoffnung auf Leben war fast auf Null gesunken.
Doch dann wurden Sie evakuiert – können Sie beschreiben, wie die Ausreise aus Pakistan lief?
Eines Nachts vibrierte drei Uhr nachts mein Telefon. Meine Mutter weckte mich und sagte: „Ich glaube, wir sollen jetzt evakuiert werden.“ Vor Angst und Unruhe, ohne jedes offizielle Dokument und nur mit einem Personalausweis, stiegen wir in ein Auto, in dem eine weitere Familie saß – auch sie hatten mit deutschen Organisationen gearbeitet. Das Auto fuhr los, doch bevor wir eines der Stadttore erreichten, stießen wir mit einem Lastwagen zusammen. Gott hat uns gerettet. Nach einer Stunde Wartezeit fuhren wir mit einem anderen Wagen weiter Richtung pakistanische Grenze.
Um 8:31 Uhr standen wir in einer Reihe von Tausenden, die wie wir ohne Pass, nur mit Personalausweis, unterwegs waren. Meine Mutter, krank und depressiv, stand von morgens bis abends aufrecht. Um 18:38 Uhr betraten wir pakistanischen Boden. Ein Weg, der normalerweise zwanzig Minuten dauerte, kostete uns an diesem Tag fast das Leben.
Trotz aller Gefahren wurde unsere Evakuierung aus Islamabad letztlich mit Hilfe der deutschen Regierung, der humanitären Menschen dieses Landes und von Organisationen wie Pro Asyl, ermöglicht. Nach etwa einem Monat kamen wir mit einem Sonderflug in Leipzig an.
Dieser Flug war für uns zugleich gefährlich und hoffnungsvoll – ein Flug aus dem Tod ins Leben. Und ich werde immer dankbar sein gegenüber den Menschen, die aus der Ferne ihre Hand der Menschlichkeit nach uns ausgestreckt haben.
Wäre es überhaupt möglich, dass Sie im heutigen Afghanistan wieder arbeiten könnten? Wie sehen Sie die Perspektiven in Afghanistan?
Nein! Wie sollte man mit einer derart unwissenden und blutbefleckten Gruppe zusammenarbeiten? Mit einer Bewegung, deren Hände im Blut Tausender Menschen getränkt sind und in deren Verhalten und Denken sich keinerlei Spur von Menschlichkeit zeigt? Vielleicht können manche im Rahmen unmoralischer und eigennütziger Politik einen oberflächlichen Umgang oder gar Handel mit ihnen pflegen – für mich ist das jedoch völlig unmöglich. Das Leben im heutigen Afghanistan hat seine eigentliche Bedeutung verloren. Dort bedeutet es nur noch atmen, nicht mehr leben.
Leben hat bestimmte Grundpfeiler: Freiheit, Sicherheit, Bildung, Arbeit, Hoffnung und das Recht auf eigene Entscheidungen. In einem Land, in dem Frauen vom Studium ausgeschlossen werden, der Stift gebrochen wird und die Angst in jedem Haus nistet, kann man nicht mehr von „Leben“ sprechen.
Noch immer warten über 2.000 Afghanen und Afghaninnen auf Ausreise nach Deutschland – obwohl diese bereits eine Aufnahmezusage hatten, weil. Einige dieser Menschen wurden bereits aus Pakistan nach Afghanistan abgeschoben. Wie beurteilen Sie diese Situation?
Dies ist eine verbindliche rechtliche und politische Verpflichtung, die umgesetzt werden muss. Gemäß § 22 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland haben Personen, die außerhalb Deutschlands anerkannt sind und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, das Recht auf Einreise und rechtlichen Schutz. Jede Verzögerung und jedes Zögern erhöht das Leid, die Angst und die Verzweiflung derjenigen, die auf ihre Überführung warten.
Die Rückführung von Personen, die legal für eine Überführung vorgesehen sind, verstößt vollständig gegen humanitäre Grundsätze, das Völkerrecht und das nationale Recht Deutschlands und ist in keiner Weise zu rechtfertigen. In manchen Ländern mag der Wert von Menschen übersehen und Gesetze gebrochen werden, doch ein Land wie Deutschland, das sich stets an nationale und internationale Rechtsnormen gehalten hat, trägt eine rechtliche und menschliche Verantwortung, die nicht ignoriert werden kann.
Nach ihrer Evakuierung wurden Sie in Sachsen untergebracht: Wie lief Ihr Ankommen in Bautzen?
Unsere Ankunft in Bautzen war geprägt von Angst und Ungewissheit. Zunächst wurden wir getäuscht: Uns wurde gesagt, dass unser Ziel in der Nähe von Hamburg liege, wo Verwandte von uns leben. Doch plötzlich fanden wir uns in Bautzen wieder, einer Stadt, deren Namen ich zuvor nicht einmal gehört hatte.
In Interviews und auf Formularen hatte ich deutlich angegeben, dass mehr als 20 unserer Verwandten in Hamburg und Umgebung leben und dass wir in diese Region gebracht werden möchten.

Man sagte mir, die Anfrage werde geprüft, doch es kam kein Ergebnis. Letztendlich verstanden wir, dass wir mehrere Jahre in Bautzen bleiben müssen und kein Recht auf eine Verlegung in die Nähe unserer Familie in Hamburg haben. Diese Diskriminierung und Ungerechtigkeit war für uns sehr belastend.
Wie ist das Leben dort heute für Sie?
Das Leben in Bautzen ist mit vielen Herausforderungen verbunden. Meine Mutter ist aufgrund von Angst und Depressionen manchmal nicht in der Lage, das Haus zu verlassen, und wir haben wiederholt feindselige und beleidigende Begegnungen erlebt. Mehrfach versuchte sogar ein Erwachsener, seine Gehhilfe gegen meine Mutter zu erheben, doch ich konnte dies verhindern und meldete den Vorfall bei der Antidiskriminierungsstelle.
Dennoch gibt es auch freundliche und hilfsbereite Menschen in Bautzen, die uns gelegentlich unterstützt haben. Manchmal zeigten sich fremde Menschen in unserer Umgebung großzügig und respektvoll, was uns wieder ermutigte.
Wie gehen Sie mit diesem doch eher bedrückendem Alltag um?
Trotz der Schwierigkeiten habe ich versucht, mein Leben aufzubauen: Studium, Sprachlernen und ehrenamtliches Engagement. Heute habe ich das B2-Zertifikat und bereite mich auf C1 vor. Der Weg war hart, doch Hoffnung und Einsatz für die Zukunft lassen uns weitermachen.
In den vergangenen drei Jahren haben wir gelernt, mit Angst und Diskriminierung zu leben, doch jeden Tag suchen wir nach Möglichkeiten, unsere Situation und die unserer Familie zu verbessern. Meine Mutter leidet weiterhin unter Angst und Depressionen, aber ich bemühe mich, durch Bildung und gesellschaftliches Engagement ein Leben mit Wert und Perspektive für uns beide zu schaffen. 

Wie sind Sie in Kontakt mit dem Verein „Willkommen in Bautzen“ gekommen? Wie läuft Ihr Ehrenamt für den Verein?
Einige Monate nach meiner Ankunft in Bautzen lernte ich zufällig Frau Susett Mildner kennen – eine aufrichtige, gebildete und ethisch handelnde Person. Eine Englischlehrerin, die mehrere weitere Sprachen beherrscht und eine der wahren Heldinnen der Geschichte von Migranten in Bautzen ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich, hätte ich Susett und diese Organisation nicht kennengelernt, bereits in den Norden oder Westen Deutschlands gegangen wäre und die Erfahrung in Bautzen verpasst hätte.
Und wie genau begann dort ihre ehrenamtliche Tätigkeit?
Von Anfang an begann ich aufgrund meiner Englischkenntnisse, mich für persischsprachige Migranten zu engagieren. Wir trafen uns zunächst in der Innenstadt, neben einem Optikgeschäft. Einige Wochen später wurde ich für ein afghanisches Kind als Übersetzer eingesetzt, damit es medizinische Leistungen erhalten konnte, und dort begann unsere freundschaftliche Zusammenarbeit.
Einige Monate später stellte Susett mich offiziell mit den Dokumenten des Vereins Willkommen in Bautzen vor und meldete mich als Übersetzer und offizieller Ehrenamtlicher an. Seitdem bin ich nun seit über drei Jahren Tag und Nacht für Migranten tätig und betrachte dies als meine menschliche Pflicht. Selbst außerhalb der offiziellen Zeiten stehe ich manchmal nachts und mitten in der Nacht bereit, um jemandem zu helfen, der krank ist oder ein Problem hat.

Die Zusammenarbeit mit Susett und dem Verein Willkommen in Bautzen hat mir gezeigt, dass in jeder Gesellschaft die Mehrheit der Menschen gut und menschlich ist, während eine kleine Minderheit anders handeln kann – sei es in Afghanistan, Deutschland oder einem anderen Land. Anderen zu helfen und die Menschlichkeit zu unterstützen, geht über Grenzen und Nationalitäten hinaus, und ich halte fest an diesem Glauben.
Können Sie kurz beschreiben, was Sie im Projekt „Traces of Memory“ – in dem sie später ausgezeichnet wurden – gemacht haben?
Parallel zum Deutschlernen und zum Online-Studium für meinen Masterabschluss war ich in internationalen Programmen und Projekten aktiv. Unter anderem nahm ich am Projekt „From Memory to Action“ teil, das Besuche in NS-Zwangsarbeitslagern beinhaltete: eine Pulverfabrik in Deutschland und Mauthausen in Österreich.
Das Programm dauerte drei Tage in Deutschland und drei Tage in Österreich, in denen wir die Geschichte, Forschung und menschlichen Erfahrungen der Opfer untersuchten. Während dieser Besuche habe ich fotografiert, Gedichte geschrieben und Geschichten entwickelt. Ich verfasste ein Gedicht über die Pulverfabrik und die Zwangsarbeit, das demnächst in Italien veröffentlicht wird, und eine emotionale Geschichte über Mauthausen, in der ich mich in die Lage der damaligen Gefangenen versetzte.
Nach Abschluss des Programms erhielt ich eine E-Mail der Veranstalter, dass meine Arbeiten – Fotos und Geschichten – am internationalen Festival dieses Projekts teilnehmen könnten. Die Teilnahme an diesen Projekten ermöglichte es mir auch, eine tiefere Verbindung zur Geschichte, Erinnerung und den Erfahrungen der NS-Opfer herzustellen und ihre Stimmen auf literarische und visuelle Weise widerzuspiegeln.
Wann kam die Idee, dass Sie sich für den Preis bewerben und wann haben Sie Ihre Arbeit für die Erinnerungskultur der deutschen Geschichte begonnen?
Als ich die Ausschreibung des Wettbewerbs „Traces of Memory“ sah, beschloss ich, mit meinen Fotos und Geschichten teilzunehmen. Wenige Tage später erhielt ich die Nachricht, dass ich zu den zehn Besten gehörte – unter Dutzenden von Teilnehmern aus 18 verschiedenen Ländern weltweit.
Obwohl ich Afghane bin, nahm ich im Auftrag Deutschlands an diesem Projekt teil. Von den zehn Besten stammten nur drei aus Deutschland, die übrigen sieben aus anderen Ländern. Diese Auswahl bedeutete für mich, dass meine Stimme gehört wurde – die Stimme eines afghanischen Migranten, der in Deutschland für die Erinnerungskultur und das Gedenken an die Geschichte arbeitet.
Der Fotowettbewerb „Traces of Memory“ wird von der EVZ-Stiftung veranstaltet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können Fotos einreichen, die sich auf ihre Projekte der letzten Jahre beziehen, zusammen mit einer kurzen Erklärung oder Geschichte. Eine Jury wählt die zehn besten Fotos aus, und die Gewinnerinnen und Gewinner werden eingeladen, am Jubiläumsprogramm #5YPRI – Connecting Communities of Remembrance in Berlin teilzunehmen.
Durch die Teilnahme an diesem Projekt konnte ich sowohl als Fotografin als auch als Dichterin und Schriftstellerin einen kleinen Beitrag zur Bewahrung der Erinnerung an die Opfer der Geschichte leisten und die Stimme von Migranten und jungen Menschen sein, die die Geschichte nicht vergessen.
Wie haben Sie diesen Abend erlebt und war es etwas Besonderes für Sie?
Der Abend in Berlin war für mich sehr emotional. Einerseits war ich Vertreter Deutschlands, andererseits liegen meine Wurzeln in Afghanistan. Ich hatte das Gefühl, zwischen zwei Welten zu stehen: der Kultur, die mich aufgenommen und zu meinem neuen Zuhause gemacht hat, und dem Land, aus dem ich komme und das meine Identität und Erinnerungen geprägt hat.
Ich verbrachte die Nacht der Veranstaltung mit einer Freundin, die ebenfalls Migrantin und Preisträgerin war, und wir spazierten durch Berlin. Wir sprachen über unsere Freuden, unsere Schmerzen und über das geografische Schicksal, das uns auf unterschiedliche Wege geführt hat.

In unseren Gedanken kehrten wir manchmal zurück zur Pulverfabrik, manchmal zu Mauthausen, manchmal nach Auschwitz und anderen Zwangsarbeitslagern. Wir beobachteten auch Gruppen von Extremisten, die ähnlich wie die Taliban agieren, und sahen, wie sehr ihre Ideologien in ihrem Extremismus übereinstimmen – ebenso wie vergleichbare Gruppen weltweit. Dieses Erlebnis war eine Mischung aus Freude, Erinnerung an vergangenes Leid und Reflexion über die Wege von Menschlichkeit und Extremismus; eine Nacht, die historisch, persönlich und zugleich eine Reflexion meiner Migrationserfahrung und Identität als Afghane in Deutschland war.
Können Sie aus Ihren Erfahrungen anderen Migrant*innen in Sachsen Ratschläge geben, um hier erfolgreich anzukommen?
Mein Rat ist einfach, aber entscheidend: Man muss sich unermüdlich und mit voller Kraft anstrengen. Wahre Fortschritte entstehen oft mitten in Entbehrungen und Herausforderungen. Sachsen und einige andere östliche Bundesländer Deutschlands bieten engere Strukturen und größere Herausforderungen. Aber auch hier leben aufrichtige und hilfsbereite Menschen, die bereit sind zu helfen. Es genügt, den Willen zu haben, die Hoffnung nicht zu verlieren und niemals aufzugeben.
Für Erfolg hier sollte Bildung und berufliche Ausbildung oberste Priorität haben. Jeder Migrant sollte zumindest eine Ausbildung absolvieren und wenn es möglich ist, danach den Weg zu Universität, Master, Promotion und sogar Postdoc verfolgen. Jeder Schritt auf dem Bildungsweg ist eine Brücke zu Unabhängigkeit, Selbstachtung und einer besseren Zukunft.
Gleichzeitig glaube ich, dass eine Gesellschaft durch Dialog verändert wird, nicht durch Schweigen. Man sollte mit Menschen unterschiedlicher Ansichten, selbst mit extrem rechten Gruppen oder solchen mit rassistischen Einstellungen, respektvoll, aber wissenschaftlich und rational kommunizieren. Man darf keine Angst haben zu sprechen, zu erklären oder gegen falsche Gedanken einzustehen. Ein gut geführter und menschlicher Dialog kann Mauern einreißen und zu einem gemeinsamen Verständnis führen, in dem Menschlichkeit über allem steht.
Was sind Ihre Wünsche für Sie selbst und Ihre Familie?
Meine Wünsche gelten nicht nur mir selbst; ich bete stets für alle, denn ich glaube, das Herz eines Menschen sollte so groß sein, dass es den Schmerz und die Hoffnung anderer aufnehmen kann. Für meine Mutter wünsche ich mir, dass sie eines Tages wieder ruhig lächeln kann – ein Lächeln, das seit Jahren unter dem Schatten von Angst, Vertreibung und Krankheit verloren gegangen ist.
Für Sachsen und Ostdeutschland wünsche ich mir, dass sie eines Tages von engen, extremen und verbitterten Denkweisen befreit werden – damit meine ich die Menschen mit solch engstirnigen Ansichten, nicht die aufrichtigen und menschlichen Menschen dieser Region. In diesem Land schlagen noch immer große und mit Menschlichkeit erfüllte Herzen.
Ich glaube daran, dass der Tag kommen wird, an dem Unterschiede nicht als Trennungsgrund dienen, sondern als Brücke für Verständnis, Respekt und Mitgefühl. Ich wünsche mir eine freundlichere Welt, ehrlichere Menschen und echte Lächeln, sodass jeder an jedem Ort in Ruhe und Würde leben kann.
Bildquellen
- wanman-uthmaniyyah-0dS1XLq9NJc-unsplash(1): Wanman Uthmaniyyah - Unsplash.com