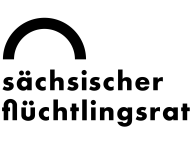Kettershausen: ein idyllisches Dorf in Bayern, zugleich ein Ort des Wartens und der Sprachlosigkeit. Der Text erzählt vom Alltag Geflüchteter im Abseits – zwischen Bushaltestellen, Maisfeldern und misstrauischen Blicken.
von Mehmet Yılmaz*

Kettershausen. Sagt dir was? Nee, nä? Ich wüsste ja auch gar nicht, dass Deutschland so ein hübsches Dorf hat, wenn mich die lieben Behörden des BAMF nicht dorthin geschickt hätten.
Meine Karriere als Asylbewerber, die in Chemnitz begann, endete nach 4 Jahren in Kettershausen. Als ich dort ankam, lebte ich schon lange in einem Deutschland, in dem ich die deutsche Sprache nur noch brauchte, um Tabak zu kaufen. Aber am Ende der Jahre des Wartens und des Sich-Verschließens verspürte ich den bangen Wunsch, noch einmal zu versuchen, mich dem Hier und Jetzt zu nähern – aber dafür war ich genau am falschen Ort!
In einem türkischen Gedicht heißt es: “Ein Dorf, das nur die kennen, die es kennen mussten”. Genau das ist Kettershausen. Dabei ist es ein Musterdorf im Freistaat Bayern: Riesige Maisfelder, eine grüne Ebene wie auf einer Postkarte, hier und da weht die bayerische Fahne mit dem stolzen Löwen darauf, kurvige Spazier- und Radwege und dazwischen mehrere gepflegte Jesüse am Kreuz… Eine Idylle zum Entspannen und Genießen, ein Ort der Entschleunigung, könnte man sagen. Das Muhen der Kühe, das Wiehern der Pferde, das Gackern der Hühner und vieles mehr: Ein Maler, der das Stillleben zu schätzen weiß, könnte hier die Seele baumeln lassen!
Schöne Aussicht. Punkt.
Das Dorf erreichst du über eine kleine Stadt namens Memmingen mit einer öffentlichen Buslinie und die Fahrpläne wirken auf den ersten Blick beängstigend rätselhaft, wenn du noch kein Deutsch sprichst. Wenn du den einen Bus verpasst, kommt der nächste erst in zwei Stunden – aber die Stadt hat zu wenig Straßen, auf denen man sich lange genug unterhalten kann. Zum Nachdenken bist du verdammt, wenn du immer so lange warten musst: Erst an der Haltestelle, dann im Warteraum der Asylbehörde. Wenn du dich dann doch mal von Gedanken und Erinnerungen lösen und dem Hier zuwenden willst, siehst du durchs Busfenster die kurvigen Straßen zwischen den Lego-Dörfern: “Wow, ist das grün hier!” Die Aussicht kann sich am Ende sehen lassen, aber die menschlichen Berührungen sind für meinen Geschmack etwas zu viel. Auf dem Hügel neben der Bushaltestelle hat man dann aber “tatsächlich” eine schöne Aussicht – das merkt man sofort, denn auf dem Straßenschild steht genau das: “Schöne Aussicht”. Punkt. Hier scheinen die Straßen nicht nach Blumen benannt zu werden.
 Im Dorf ist niemand auf den Bus angewiesen. Vor jedem Haus steht mindestens ein Auto, vor manchen zwei, vor einigen drei. Die autolosen Geflüchteten im Dorf schlendern mit langsamen, nachdenklichen Schritten auf dem Radweg zwischen der Autostraße und den Maisfeldern, wenn sie wieder einmal den Bus verpasst haben. Es kommt vor, dass sie schnell etwas Mais in die Tasche stecken, wenn in der Ferne niemand zu sehen ist. Wenn sie es schaffen, den Bus zu erreichen, und der Bus nicht gerade von Schulkindern wimmelt, sitzen die Geflüchteten oft unter sich: Der Bus mit ein paar Geflüchteten fährt von Dorf zu Dorf in den Tiefen des Allgäu-Schwaben. (Hascht du ‘ne Fahrkarte?)
Im Dorf ist niemand auf den Bus angewiesen. Vor jedem Haus steht mindestens ein Auto, vor manchen zwei, vor einigen drei. Die autolosen Geflüchteten im Dorf schlendern mit langsamen, nachdenklichen Schritten auf dem Radweg zwischen der Autostraße und den Maisfeldern, wenn sie wieder einmal den Bus verpasst haben. Es kommt vor, dass sie schnell etwas Mais in die Tasche stecken, wenn in der Ferne niemand zu sehen ist. Wenn sie es schaffen, den Bus zu erreichen, und der Bus nicht gerade von Schulkindern wimmelt, sitzen die Geflüchteten oft unter sich: Der Bus mit ein paar Geflüchteten fährt von Dorf zu Dorf in den Tiefen des Allgäu-Schwaben. (Hascht du ‘ne Fahrkarte?)
Vom Himmel gefallen
Die Dorfgemeinschaft besteht überwiegend aus älteren Menschen, und alle scheinen sich über uns zu wundern. “Wer sind die denn jetzt?”, denken sie bestimmt, “Kann der Staat in ganz Deutschland keinen anderen Ort finden, um ‘die’ unterzubringen?” (Leider reichte mein Deutsch damals bei weitem nicht aus, um sie wirklich zu verstehen, aber die universelle Sprache des Verhaltens sagte oft so etwas.)
Immer noch muss ich lächeln, wenn ich an die alten Leute denke, die meinen Weg durch die Nix-Los-Straße mit ihren Blicken aus ihren Fenstern begleiteten. Mich jedes Mal zu fragen, was sie wohl dachten, war einer der guten Zeitvertreibe dieser Tage. (Wie kann man sich in dieser Sprachlosigkeit überhaupt verständigen, wenn nicht mit den Augen? Wie sonst soll doch die Zeit vergehen!)
Es war schon eine komische Situation, in die man uns gebracht hat. Geflüchtete werden ohne Orientierung und ohne Sprache in ein abgelegenes Dorf auf irgendeinem Berg in einem fremden (noch dazu deutschen) Land geschickt. Wie überall leben die Dörfer auch hier mit ihren Routinen, und die kleinste Intervention ist ein Ereignis, eine Nachricht, ein Thema. Hier ist es am schwierigsten, etwas zu verändern – aber wir sind hier. Wir haben ja keine Ahnung. Wohin man uns auch schickt, dort müssen wir warten.
Die Unterkunft ist ein Einfamilienhaus mit Garten, einem Apfelbaum und den Spuren eines abgerissenen Swimmingpools. Aus der Perspektive der Dorfbewohner*innen, die ohnehin kaum Kontakt zur Außenwelt pflegen (wollen), waren wir wohl wie vom Himmel gefallen – aber nicht wie etwas Heiliges, sondern wie aus der Toilette eines Flugzeugs oder so. “Die kommen, bekommen ein Zimmer in einem schönen Haus, wo früher sogar ein Swimmingpool war, belauern unsere Frauen und tragen nichts bei!” Ein Kontakt, gar auf Augenhöhe, scheint hier selbst in verträumter Naivität weit entfernt von der Möglichkeit.
Was machst du in diesem Dorf? Wie füllst du deine Freizeit aus, die du wegen der Arbeitslosigkeit und der trostlosen Stille des Dorfes reichlich hast?
Unter den Hunden der Deutschen
Eines der ersten Gespräche, das die Menschen in den Asylbewerberheimen unbedingt führen wollen, ist, wenn jemand sagt: “Bruder, pass mal auf: Wir sind hier nicht in der dritten, nicht einmal in der vierten Klasse. Hast du schon überall die Hunde der Deutschen gesehen? Wir sind noch unter ihnen!”
Die vielen guten Menschen möchte ich keineswegs vergessen, die mit dem Slogan „Kein Mensch ist illegal“ kämpfen, oder die alte Frau, die mir mit einem warmen Lächeln die Hand schüttelte und sagte: „Herzlich willkommen!“ Doch müssen wir über den Rassismus reden: Er entsteht an Fließbändern und in Ämtern und breitet sich auf der Straße aus – in allen möglichen Begegnungen. Irgendwann lernt man, damit zu leben – vielleicht hält man es sogar für die Natur der Dinge, wie schnell sich Menschen berechtigt fühlen, eine*n so grob zu behandeln. Viele fangen an, die Fehler zuerst bei sich selbst zu suchen, und manche verfallen sogar in eine entschuldigende Haltung. Das möchte ich lieber mit der Wärme der Erfahrung zum Ausdruck bringen.
Mit Bier gegen Rassismus?
In der Nähe unseres Dorfes gab es noch eine dorfartige Kleinstadt namens Babenhausen mit etwa 5 Tausend Einwohner*innen. Einmal, als ich gezwungen war, mehr als zwei Wochen im Dorf zu bleiben, und ich vor Langeweile fast eingeschlafen war, sah ich an der Bushaltestelle ein Plakat für ein Konzert in Babenhausen. Ich nahm in Kauf, den Rückweg zu Fuß zurücklegen zu müssen, und beschloss, auf das Konzert zu gehen und damit auch einmal unter Leute zu kommen. Das Konzert fand in einem Park auf der Wiese statt. Weil ich bis zum Konzert in den wenigen Straßen der Stadt hin und her schwebte, war ich einer der ersten Zuschauer*innen. Auf den Wiesen standen Bänke mit Tischen, und ich setzte mich auf eine davon. Aufgrund der Befürchtung, dass ich mit meinem Bart und Rucksack die so empfindlichen Bürger*innen erschrecken könnte, entschied ich mich, wie blöd es auch immer war, mir eine Flasche Bier zu kaufen. (Ich war ja sprachlos und mit so vielen Augen gleichzeitig konnte ich doch kein Gespräch führen!) Damals gab es immer wieder Anschläge von ISIS, und mit einer Flasche Bier wollte ich der Gefahr vorbeugen, für einen Islamisten gehalten zu werden.
Konzert auf der Wiese
Endlich trat die Band mit einer schönen Solistin auf der kleinen Bühne auf: Die Musik war schön, und es war auch schön, nach langer Zeit wieder in einer unbeschwerten Atmosphäre unter Menschen zu sein. Nach und nach füllten sich die Bänke: Das Konzert schien die Aufmerksamkeit der Einwohner*innen erregt zu haben. Außerdem war der Kulturkalender von Babenhausen nicht gerade prall gefüllt. Also: Alle, die es schafften, waren wohl hier – allerdings nur weiße Deutsche. Plötzlich wimmelte es um mich herum von Menschen und ihren Geräuschen. Alle Bänke waren besetzt – auf der Bank neben mir saßen sieben Leute, teilweise übereinander. Ich allein hatte eine Bank für sechs Personen. Wenn sich die Leute um mich herum unterhielten, hatte ich immer den Verdacht, dass sie über mich redeten und wollten, dass ich die Bank endlich frei mache. Mehr als ein paar misstrauische Blicke konnte ich nicht erkennen. Ich dachte an das viral gegangene Video von einem alten Kurden, der an Türk*innen adressiert schrie: “Wir würden euch nicht fressen!” Ich wollte lieber „Ich fresse euch nicht, Leute! Hier ist eure Bank!” rufen und weggehen, aber am Ende musste ich aufstehen und so unauffällig wie möglich gehen.
PS: Die Bilder stammen aus der Langeweile des Verfassers in Kettershausen.
* Dieser Text ist der 7. Ausgabe unseres Jahresmagazins „Querfeld“ entnommen.